Mag. Lukas Cioni
Redaktionsleiter / Chef vom Dienst
miteinander-Magazin
Stephansplatz 6
1010 Wien
Tel.: +43 1 516 11-1500
Sie haben eine neue Adresse? Schreiben Sie uns hier oder rufen uns unter DW 1504 an.
miteinander 9-10/2025
In den letzten 25 Jahren sind die Demokratien ins Wanken gekommen. Warum haben sie an Stabilität verloren?
Politik bewegt sich wie ein Pendel, das zuerst in die eine und danach in die andere Richtung ausschlägt. Auf Demokratisierungswellen folgen häufig Gegenwellen der Autokratisierung. Seit der Jahrtausendwende beobachten wir weltweit, dass Demokratien zwar nicht stürzen, aber in ihrer Qualität erodieren. Dies gilt von Südkorea über Indien bis hin zu den USA, am wenigsten noch für West- und Nordeuropa. Die Demokratien wirken erschöpft. Sie lösen nicht die fundamentalen Probleme wie den Klimawandel, die äußere und innere Sicherheit oder die ungleiche Verteilung von Lebenschancen.
Was hat neben den Sozialen Netzwerken, durch die wir uns wie in Blasen bewegen, noch zur politischen und gesellschaftlichen Spaltung geführt?
Die Ungleichheit, und dass sich daran nichts ändert. Bildungsferne und untere Gesellschaftsschichten können mit kosmopolitischen Ideen wenig anfangen. Viele Menschen fühlen sich von der Politik nicht richtig repräsentiert. Das gilt auch für Österreich und Deutschland. Neben der Politik bestimmen die Medien den öffentlichen Diskurs: Doch analoge Medien wirken auf viele Menschen belehrend, während digitale Medien mit den Sozialen Netzwerken unseren Diskursradius einschränken. Sie animieren zu einer radikalisierten Form des gesellschaftlichen Ausdrucks, weil das "Klicks" und "Follower" bringt. Diese in den Sozialen Medien eingebaute Mechanik führt zu Radikalisierung, Polarisierung und gesellschaftlichen Gräben.
Wo würden Sie derzeit Österreich verorten auf einer Skala von 1-10, wenn 1 eine ideale Demokratie und 10 eine totalitäre Autokratie beschreibt?
Österreich ist gerade noch eine liberale Demokratie, also eine 7. Im Vergleich zu Staaten wie Äthiopien oder Nordkorea steht Österreich natürlich blendend da. Aktuell liegt Österreich auch klar vor seinem Nachbarn Ungarn, einer hochgradig defekten Demokratie mit autoritären Zügen. In Österreich gibt es aber eine der vitalsten rechtsradikalen- bzw. populistischen Parteien, die trotz bizarrer Skandale einen grossen Rückhalt in der Bevölkerung hat.
Die FPÖ wurde zuletzt stärkste Kraft in Österreich, in Deutschland wurde die AfD an die zweite Stelle gewählt. Ist es demokratisch, dass diese Parteien nun nicht in der Regierung vertreten sind?
Ja, denn sie haben keine absoluten Mehrheiten, die sie für sich beanspruchen können und müssten einen Koalitionspartner finden. Den haben sie bisher nicht. Undemokratisch wäre es, die AfD oder die FPÖ zu verbieten. Das würde ihnen nur die Möglichkeit geben, sich wieder als Opfer der anderen Parteien darzustellen. Außerdem würde man in Österreich 30 Prozent des Staatsvolkes bescheiden: Ihr seid politisch unmündig. Bei einem Verbot müssten der AfD in Deutschland Tausende von gewählten Mandaten weggenommen werden – vom Bund bis zu den Stadträten. In Ostdeutschland würde das bürgerkriegsähnliche Zustände hervorrufen. Wir leben in einer Zeit der Ambivalenz. Darauf deutet auch der Untertitel Ihres neuen Buches hin: "Zerbrechlichkeit und Resilienz der Demokratie im 21. Jahrhundert".
Was hilft Ihnen dabei, Unterschiede auszuhalten und mit Unsicherheiten auszugehen?
Gespräche, Diskurse und Debatten. Irgendwann drängt das Pro- und Contra aber dazu, eine Bilanz zu ziehen. Ich zwinge mich zu einer Positionierung, die mich handlungsfähig macht. Dabei helfen mir Gespräche mit Menschen, die mir nahe stehen, mehr als die öffentliche Debatte, die selbstverständlich auch wichtig ist.
Das heißt, es ist besser, Entscheidungen zu treffen als im Stillstand zu verharren?
In der Politik sowieso! In unserer komplexen Gesellschaft müssen diese politischen Entscheidungen auch nicht schwarz-weiss sein. Denn die bessere Art zu regieren ist, zu fairen Kompromissen zu kommen, Minderheiten zu schützen und nicht in Trumpscher Manier zu sagen: "Mich legitimiert eine Mehrheit! Ich kann durchregieren!"
2022 unterzeichneten Sie einen offenen Brief an Kanzler Olaf Scholz, in dem sie sich aus Sorge vor einem dritten Weltkrieg gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aussprechen. Sind Sie drei Jahre später immer noch dieser Meinung?
Ich habe mich aus dem öffentlichen Diskurs zurückgezogen, nachdem ich mit Hasstiraden überzogen wurde. Wir können die bisher gelieferten Waffen nicht mehr zurückziehen, gleichzeitig verlängert unser Beistand nur das Sterben, denn die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen. Das ist eine der Ambivalenzen unserer Zeit.
Die derzeitige Aufrüstungsspirale bezeichnen Sie als "chaotischen Alarmismus". Wie können wir diese stoppen?
Es geht nur über Argumente. So bitter es ist, ich sehe keine andere reale Möglichkeit, als dass der Aggressor Russland temporär als Gewinner aus diesem Krieg hervorgeht. Wir können gar nicht so aufrüsten, dass Europa allein verteidigungsfähig gegen die stärkste Nuklearmacht der Welt ist.
Was kann jeder und jede Einzelne tun, um die Demokratie zu stärken und für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft zu sorgen?
Sich einmischen, sei es in der Nachbarschaft, in Nichtregierungsorganisation oder in der Zivilgesellschaft. Nicht einfach übernehmen, was vorgekaut wird. Und auch wenn Parteien derzeit unbeliebt sind: Sie sind die wichtigsten Akteure einer repräsentativen Demokratie. Nur auf die Strasse zu gehen, verändert nicht die Agenda, übersetzt sich nicht in problemlösende Politik.
Apropos Demonstrationen: Als junger Mann haben Sie sich in linken Gruppen engagiert und wurden vom Verfassungsschutz beobachtet. Weil sie demonstrierten, bekamen Sie zunächst ein Jahr lang keine Anstellung an der Uni als Hilfswissenschaftler. Sind Sie heute noch auf Demos anzutreffen?
Als Teilnehmer schon länger nicht mehr. Zuletzt ging ich auf eine rechte Demo und auf Demos "pro" und "contra" Waffenlieferungen – jedoch nur als Beobachter. Sie haben mich nicht überzeugt, die Argumentationen waren zu holzschnitzartig.
Es heißt, Sie stammen aus einem protestantischen Elternhaus. Hat dies Ihr Verständnis von Demokratie und "Sich-Einmischen" geprägt?
Meine Mutter blieb bis zuletzt katholisch, mein Vater war Atheist – nicht alles, was auf Wikipedia über mich steht, stimmt (schmunzelt). Von uns fünf Kindern ist keiner in der Kirche geblieben, ich selbst bezeichne mich als Agnostiker. Mehr als ein religiöser Spirit haben mich die preussisch-protestantische Ethik, das Leisten-Müssen, geprägt. Das war auch Aufbegehren gegen die Generation unserer Eltern in den 1970ern. Empört waren wir über die schreiende Ungerechtigkeit auf der Welt. Vor allem aber protestierten wir gegen den Vietnam-Krieg, der jeden Abend über den Fernseher ins Wohnzimmer kam.
Die Empörung ist verflogen und einer Skepsis in Bezug auf die Lage der Demokratien gewichen. Was stimmt Sie heute persönlich zuversichtlich angesichts der multiplen Krisen, der ungewissen Zukunft und der politischen Umbrüche?
Die Demokratien in Westeuropa mit ihren Vorteilen sind so verankert in einer Mehrheit der Bevölkerung, dass sie vermutlich nicht kollabieren werden. Ich schließe wie gesagt nicht aus, dass sie erodieren, oder es – von den USA befeuert – zu Einschränkungen individueller Freiheits- und Gleichheitsrechte kommt. Da wird die Gesellschaft standhaft sein müssen. Sie dürfte zunächst illiberaler werden. Aber weder die Großideologien des Faschismus noch des Kommunismus haben gegenwärtig bei uns eine Chance.
Dr. Wolfgang Merkel
war von 2004 bis 2020 Direktor der Abteilung "Demokratie und Demokratisierung" am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und Professor für Politische Wissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Buchtipp
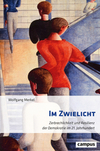
Merkel, Wolfgang: Im Zwielicht. Zerbrechlichkeit und Resilienz der Demokratie im 21. Jahrhundert. Campus-Verlag, Frankfurt am Main: 2023, ISBN 978-3-593-51780-3, € 39,00