Mag. Lukas Cioni
Redaktionsleiter / Chef vom Dienst
miteinander-Magazin
Stephansplatz 6
1010 Wien
Tel.: +43 1 516 11-1500
Sie haben eine neue Adresse? Schreiben Sie uns hier oder rufen uns unter DW 1504 an.
miteinander 11-12/2024

Herr Prof. Loffeld, die christlichen Kirchen machen derzeit keine gute Figur. Ist der Gläubigen- und Relevanzverlust nur eine Folge von Skandalen oder steckt mehr dahinter?
Ich würde sagen, dass Teile der Kirchenkrise sich auch aus einem Entbettungsprozess ndes Religiösen ergeben. Das meint, Religion bekommt in verschiedenen Kulturen eine neue Gestalt. Das geschieht zumeist krisenhaft. Die katholische Kirche kam mit dem letzten Konzil von einer Abwehr- zu neiner inklusiven Haltung. Das hat jedoch ndie Transformation und den Relevanzverlust des Religiösen nicht aufhalten können. Zugleich ist der Freiheitsgewinn nicht zu
unterschätzen, den diese Entbettung bietet: Das Aufdecken vielfältiger missbräuchlicher kirchlicher Strukturen wäre ohne sie gar nicht möglich gewesen. Insgesamt würde ich sagen, dass Kirchenskandale anzeigen, wie wenig man sich erst in der neuen Situation zurechtgefunden hat. Dabei ist unstrittig, dass die Skandale die Erosionen von Kirchen und Glaube verstärken und beschleunigen.
Vor 80 Jahren formulierte der Theologe Dietrich Bonhoeffer, der Mensch könne nicht mehr religiös sein. Bewahrheitet sich ndiese frühe Prognose heute in ihrer ganzen Breite und Tragweite?
Bonhoeffer zielte damals mit seiner Rede von einem religionslosen Christentum auf eine Entfunktionalisierung des Glaubens. Das ist präzise das, was wir heute erleben: Der Glaube ist für viele Menschen nutzlos, er sagt ihnen nichts mehr. Dies wäre der positive Lernertrag aus der heutigen Situation. Der andere wäre die Frage, ob Religion bzw. die Frage nach Gott wirklich zum Menschsein notwendig dazugehört. Die Empirie zeigt uns, dass dies nicht so ist. Allerdings würde ich weniger von einem „homo areligiosus“ sprechen als vielmehr von einem „homo indifferens“. Das transzendentale Existenzial wird dann zu einem Potenzial, das man aktivieren kann, aber nicht muss. Das erlebe ich hier in den Niederlanden: Viele unserer Studierenden oder Neugetauften konnten sich vor einigen Jahren noch gar nicht vorstellen, dass sie irgendwann religiös würden.
Manche behaupten, es breche derzeit nicht der Glaube an sich weg, sondern nur eine spezielle Sozialgestalt von christlicher Religiosität, die stark aus dem 19. Jahrhundert kommt. Lässt sich diese These stützen – oder stehen wir tatsächlich in einer „Gotteskrise“?
Klar ist, dass es auch im 18. Jahrhundert schon einen Verlust von religiösen Selbstverständlichkeiten gab und die Kirche hierauf – vorläufig erfolgreich – unter anderem mit geschlossener Milieubindung reagierte. Spannend wäre die Frage, ob es auch ndamals schon für viele Menschen denkbar war, ihr Leben gänzlich ohne jegliche transzendent verbürgte Deutung zu leben. Das ist allerdings eine akademische Diskussion. Die „Gotteskrise“ unserer Zeit besteht weniger in einer bewussten Abkehr vom Glauben als vielmehr in einem Verschwinden der Gottesrelevanz überhaupt. Zugleich bleiben jedoch manche sogar trotz existenzieller Infragestellungen ihres Glaubens durch die Theodizee (Frage nach Gott angesichts des Leidens) religiös. Ein Beispiel ist der Roman „Gott braucht dich nicht“ von Esther Maria Magnis, in dem schön beschrieben wird, wie die Erfahrung von Leid nur noch tiefer in ein Ringen mit Gott führen kann.
Was folgt denn daraus, wenn – wie Ihr aktuelles Buch heißt – nichts mehr fehlt, wo Gott fehlt?
Auf individueller Ebene ist evident, dass jemand auch ein guter Mensch sein kann, wenn sie bzw. er nicht an Gott glaubt. Mehr noch: Nur wenn es die Option gibt, auch ohne den Glauben gut zu leben und glücklich zu werden, ist er wirklich erst frei. Was die gesellschaftliche Ebene angeht, erleben wir derzeit vielleicht eines der größten Langzeitexperimente der Geschichte: Wir wissen, dass alle Ideologien, die den Atheismus als Zwang verordnet haben, nicht nur gescheitert sind, sondern sich ins absolut Unmenschliche verkehrt haben.Zugleich kann man einer Gesellschaft den Glauben als Gegenmittel nicht „verordnen“. Wir müssen daher aus einer zunehmenden Minderheitenposition heraus uns so für das Gemeinwohl einsetzen, dass unmenschliche oder antidemokratische Tendenzen nicht die Oberhand gewinnen. Genau dies beobachte ich aber aktuell mit mSorge. Es wird wohl darauf ankommen, künftig für die gemeinsamen humanistischen Anliegen über verschiedene weltanschauliche Lager hinweg Verbündete zu suchen.
Da drängt sich am Ende die Frage auf, was das denn innerkirchlich und pastoral gewendet bedeuten kann bzw. wie Kirche und Theologie darauf reagieren sollten?
Wenn ich etwa sehe, wie viele Konzepte während der letzten Jahrzehnte allein in meinem eigenen Fach, der Pastoraltheologie, entworfen und wieder verworfen worden sind, möchte ich den Mund nicht zu voll nehmen. Statt großer Gesten sollten wir auf die kleinen Schritte blicken, die im Alltag lebbar sind und sich bewähren: also die tägliche pastorale Arbeit, die konkrete Lebenshilfe, das kleine Hoffnungszeichen. Wir haben als Kirchen gerade im deutschen Sprachraum immer noch so viele Kontakt- und Membranstellen des Evangeliums, an denen sehr viel Positives passiert. All das wird den Gesamttrend der Säkularisierung sicher nicht aufhalten, kann aber mehr denn je erahnen lassen, dass das Reich Gottes unfassbar und verborgen an vielen Orten anzutreffen ist. Mit Blick in die Realität ist vielleicht nicht mehr zu erwarten, aber auch nicht weniger.

Dr. Jan Loffeld
ist Professor für Praktische Theologie an der Tilburg University, School of Catholic Theology in Utrecht (Niederlande).
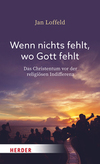
Zuletzt erschienen:
Jan Loffeld: Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Das Christentum vor der religiösen Indifferenz. Herder, Freiburg 2024, ISBN: 978-3-451-39569-7, € 22,70